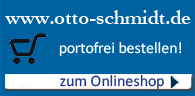Aktuell im ArbRB
Die aktuelle Rechtsprechung zum Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit im Praxistest (Korinth, ArbRB 2022, 282)
Nach § 2 Abs. 1 BetrVG sollen Arbeitgeber und Betriebsrat vertrauensvoll zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs zusammenarbeiten. Was folgt hieraus für den Betriebsrat? Aktuelle Rechtsprechung, u.a. des LAG Köln, gibt Veranlassung, diese Frage vor dem Hintergrund der jetzigen betrieblichen Wirklichkeit erneut zu untersuchen und der spiegelbildlichen Frage nachzugehen, welche Pflichten dem Arbeitgeber aus § 2 Abs. 1 BetrVG erwachsen.
I. Grundzüge
1. Theorie
2. Praxis
II. Konflikte in der Betriebsöffentlichkeit
1. Äußerungen des Betriebsrats
a) Betriebsintern
b) Öffentlichkeitsarbeit
2. Äußerungen des Arbeitgebers
a) Allgemein
b) Veröffentlichung von Betriebsratskosten
III. Einigungsstellenverfahren
1. Anrufung der Einigungsstelle
2. Auswahl der Beisitzer
IV. Beschlussverfahren
1. Mutwillige Einleitung
2. Verhalten im Verfahren
V. Informationspflichten
VI. Sonstiges Verhalten des Betriebsrats
1. Schulungsveranstaltungen
2. Koppelungsgeschäfte
VII. Fazit
I. Grundzüge
1. Theorie
§ 2 Abs. 1 BetrVG wird als die „Magna Charta der Betriebsverfassung“ bezeichnet. Das BAG spricht etwas weniger poetisch von der Anwendung des Grundsatzes von Treu und Glauben auf dem Gebiet der Betriebsverfassung. Die Betriebspartner müssen somit auf die Interessen der jeweils anderen Betriebspartei Bedacht nehmen.
Die Bedeutung der Vorschrift geht aber weit über bloßes juristisches Moltofill hinaus. Vielmehr enthält sie verbindliches, das Verhalten der Betriebsparteien regelndes, unmittelbar geltendes Recht und ist keine bloße Auslegungshilfe für andere betriebsverfassungsrechtliche Vorschriften. Sie schafft allerdings keine eigenen Mitbestimmungs- oder Auskunftstatbestände, sondern begründet eine Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme.
2. Praxis
Wie immer bei derartigen generalklauselhaften Bestimmungen kommt es darauf an, was die Praxis daraus macht.
Im „Praxistest“ fällt zunächst auf, dass die Vorschrift vielfach von der Arbeitgeberseite herangezogen wird, um Kompetenzen des Betriebsrats zu begrenzen und sein Handeln in den Bereich der Rechtswidrigkeit zu rücken.
Beispiel
Wie weit dies gehen kann, zeigt eine aktuelle Entscheidung des LAG Köln. Der Arbeitgeber hatte einen Antrag auf Auflösung des Betriebsrats nach § 23 Abs. 3 BetrVG u.a. damit begründet, dass dieser gegen den erklärten Willen des Arbeitgebers eine Betriebsvereinbarung an die Arbeitnehmer verschickt und damit gegen seine Geheimhaltungspflicht verstoßen habe. Er musste vom LAG belehrt werden, dass Betriebsvereinbarungen keiner Geheimhaltung bedürfen, sondern vielmehr gem. § 77 Abs. 2 Satz 4 BetrVG im Betrieb auszulegen sind.
Wichtig! All diesen arbeitgeberseitigen Versuchen ist die nach wie vor gültige Entscheidung des BAG (...)