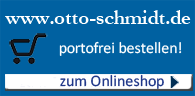Arbeitgeber mĂĽssen sich darauf verlassen können, dass einmal abgeschlossene Tarifverträge bis zu ihrer Beendigung eine verlässliche Kalkulationsgrundlage insbesondere fĂĽr kĂĽnftige Personalkosten darstellen. Diesem Ziel dient zum einen die Friedenspflicht. Zumindest während der Laufzeit eines Tarifvertrages dĂĽrfen die Gewerkschaften nicht streiken, um eine Verbesserung der tariflichen Bedingungen zu erreichen. Andererseits mĂĽssen die vereinbarten Bedingungen auch möglichst „gerichtsfest“ sein. Andernfalls besteht die Gefahr, dass einzelne Arbeitnehmer – ggf. mit gewerkschaftlicher UnterstĂĽtzung – versuchen, unter Berufung auf unwirksame tarifvertragliche Regelungen bessere finanzielle Leistungen als im Tarifvertrag vorgesehen durchzusetzen.
Arbeitgeberverbände bzw. Arbeitgeber auf der einen Seite und Gewerkschaften auf der anderen Seite können als Tarifpartner unabhängig von staatlicher Einflussnahme Tarifverträge autonom regeln. Diese Tarifautonomie ist durch Art. 9 Abs. 3 GG verfassungsrechtlich garantiert. Selbstverständlich sind auch die Tarifvertragsparteien an gesetzliche Vorgaben gebunden. Inwieweit die Gerichte aber tarifvertragliche Regelungen ĂĽberprĂĽfen dĂĽrfen, war in den letzten Jahren äuĂźerst umstritten. Eine wegweisende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat nun Klarheit geschaffen, indem es zwei Urteile des BAG (BAG v. 9.12. 2020 – 10 AZR 335/20 und BAG v. 22.3.2023 – 10 AZR 600/20, AP Nr. 36 zu § 6 ArbZG) fĂĽr verfassungswidrig erklärt hat, weil sie gegen das genannte Grundrecht des Art. 9 Abs. 3 Satz 1 GG verstoĂźen (BVerfG v. 11.12.2024 – 1 BvR 1109/21, 1 BvR 1422/23).
Die Entscheidungen des BAG betrafen Tarifverträge, nach denen Nachtarbeitnehmer einen Zuschlag von 50 %, Nachtschichtarbeitnehmer hingegen nur einen Zuschlag von 25 % erhalten. Letztere können jedoch auch in den Genuss von Schichtfreizeiten, bezahlten Pausen und kumulierten Zuschlägen kommen. Gegen diese Ungleichbehandlung klagten Arbeitnehmer. Das BAG bejahte daraufhin eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung von Nachtarbeitnehmern und Nachtschichtarbeitnehmern und verurteilte die Arbeitgeber, auch den Nachtschichtarbeitnehmern den höheren Zuschlag von 50 % zu zahlen. Das Gericht passte also den Zuschlag „nach oben“ an.
Hiergegen wehrten sich die betroffenen Arbeitgeber vor dem Bundesverfassungsgericht und bekamen Recht. Mit der vom BAG gegebenen Begründung konnte bereits keine Ungleichbehandlung durch die unterschiedliche Höhe der Zuschläge für die beiden Arbeitnehmergruppen angenommen werden.
Die Tarifvertragsparteien haben aufgrund der ihnen durch Art. 9 Abs. 3 GG gewährleisteten Koalitionsfreiheit einen weiten Gestaltungsspielraum bei Tarifnormen, die den Kernbereich der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen betreffen und bei denen ein besonderes Schutzbedürfnis nicht erkennbar ist. Eine Ungleichbehandlung bei unterschiedlichen Regelungen für verschiedene Arbeitnehmergruppen kann daher nur dann vorliegen, wenn die entsprechenden Regelungen Ausdruck von Willkür sind. Den Gerichten kommt daher nur eine Willkürkontrolle zu.
Folgerichtig hat das Bundesverfassungsgericht die Urteile des BAG aufgehoben und die Sachen wieder an das BAG zurĂĽckverwiesen. Diese haben nun zu prĂĽfen, ob die in den Tarifverträgen vorgenommenen Ungleichbehandlungen bei den Zuschlaghöhen willkĂĽrlich sind. Dabei ist zu bedenken, dass objektive WillkĂĽr vorliegen muss, d.h. die Tarifnorm muss im Verhältnis zu der tatsächlichen Situation, die sie regeln soll, objektiv unangemessen sein. Die nach dem Willen der Tarifvertragsparteien fĂĽr die Ausgestaltung der Tarifregelung maĂźgeblichen GrĂĽnde mĂĽssen sich insoweit weder ausdrĂĽcklich noch durch Auslegung dem Tarifvertrag entnehmen lassen (BAG v. 20.7.2023 – 6 AZR 256/22, ArbRB 2023, 299 [Esser]).
Zu Recht wird in der Entscheidung auch kritisiert, dass das BAG bei vermeintlich gleichheitswidrigen tarifvertraglichen Regelungen als Rechtsfolge eine Anpassung „nach oben“ vornimmt. Auch dies ist ein verfassungswidriger Eingriff in die tarifautonome Gestaltung der Arbeitsbedingungen wegen Verstoßes gegen Art. 9 Abs. 3 GG. Arbeitsbedingungen sind vorrangig von den Tarifvertragsparteien auszuhandeln und nicht von den Gerichten festzusetzen.
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist sehr ausführlich begründet. Vor dem Hintergrund, dass beim Bundesverfassungsgericht noch über 180 weitere Verfassungsbeschwerden gegen entsprechende Urteile des BAG anhängig sind, ermöglicht dies eine einheitliche Begründungslinie.
Diese Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die sicherlich zu den wichtigsten arbeitsrechtlichen Entscheidungen der letzten Jahre gehört, stärkt die Tarifautonomie. Arbeitgeber – und Arbeitnehmer – können sich deshalb zukünftig darauf verlassen, dass einmal zwischen den Tarifvertragsparteien ausgehandelte Arbeitsbedingungen bis zum nächsten Tarifabschluss gültig bleiben. Arbeitgeber, die Mitglied von Arbeitgeberverbänden sind, können nicht den Eindruck gewinnen, dass ausgehandelte Arbeitsbedingungen für sie keine sichere Kalkulationsgrundlage mehr sind. Gestärkt wird durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts damit auch die Tarifbindung.
Das höchste deutsche Gericht stützt seine Entscheidung auch auf Überlegungen des Verfassers (Kleinebrink, Die Erhöhung tarifvertraglicher Nachtzuschläge durch Urteil, NZA 2019,1458; vgl. auch Kleinebrink, Anmerkung zu BAG v. 9.12.2020 – 10 AZR 334/20, AP Nr. 21 zu § 6 ArbZG; Kleinebrink, Anmerkung zu BAG v. 22.2.2023 – 10 AZR 332/20 AP Nr. 31 zu § 6 ArbZG = ArbRB 2023, 165 [Marquardt]).